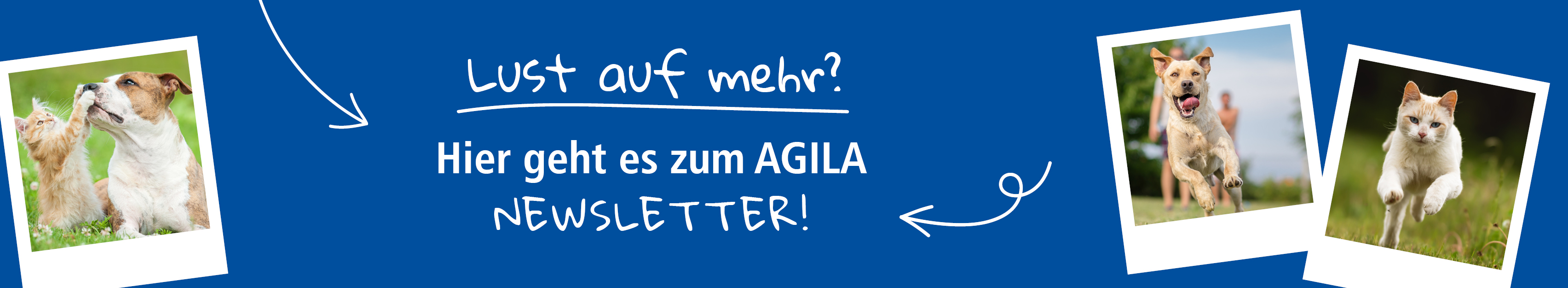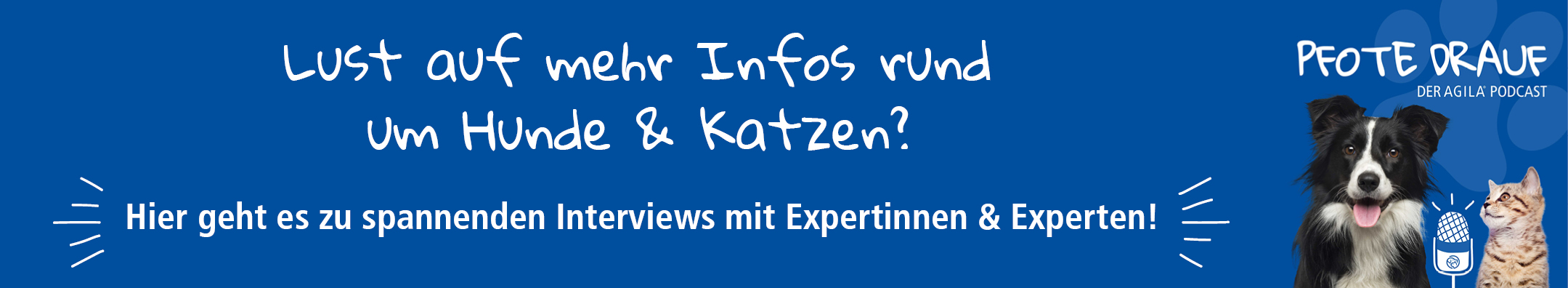Plötzlich Niesen, juckende Augen oder Husten – und das ausgerechnet bei der geliebten Katze? Eine Katzenallergie ist keine Seltenheit, aber oft gut behandelbar. Hier lesen Sie, woran Sie sie erkennen, was hilft und wie das Zusammenleben trotzdem klappt.
Inhaltsverzeichnis:
- Wie lässt sich eine Katzenallergie erkennen?
- Die Ursache der allergischen Reaktion
- Katze trotz Allergie: Gibt es geeignete Rassen?
- Behandlung der Katzenallergie – ist das möglich?
- Ist es möglich, die Katze trotz Allergie zu behalten?
- Katzenallergie bei Kindern: besondere Herausforderungen
Wie lässt sich eine Katzenallergie erkennen?
Die typischen Symptome einer Katzenallergie treten oft schon kurz nach dem Kontakt mit der Katze auf, müssen aber nicht sofort als solche erkannt werden. Die Reaktionen betreffen meist die Atemwege und Schleimhäute. Dazu gehören unter anderem häufiges Niesen, eine verstopfte oder laufende Nase, juckende, tränende oder gerötete Augen und ein unangenehmes Kratzen im Hals. Einige Betroffene berichten auch über Hautreaktionen wie Rötungen oder Juckreiz, vor allem nach dem Streicheln der Katze oder dem Kontakt mit Gegenständen, auf denen das Tier gelegen hat.
In schwereren Fällen können asthmatische Beschwerden wie Atemnot, Husten oder pfeifende Atemgeräusche auftreten. Diese Symptome sollten ernst genommen werden, denn eine unbehandelte Katzenallergie kann sich langfristig verschlimmern und im schlimmsten Fall zu allergischem Asthma führen. Ein Allergietest bei der Fachärztin oder dem Facharzt bringt Klarheit über die Ursache der Beschwerden.
Hier sind die 5 häufigsten Symptome einer Katzenallergie:
- Niesen und laufende Nase
- Juckende oder tränende Augen
- Kratzen im Hals, Husten
- Hautreaktionen nach direktem Kontakt
- Atemnot oder pfeifende Atmung
Bei einer Katzenallergie verstärken sich diese Beschwerden in der Nähe von Katzen oder in Katzenhaushalten.
Die Ursache der allergischen Reaktion
Bei einer Katzenallergie handelt es sich um eine fehlgeleitete Immunreaktion. Das körpereigene Abwehrsystem erkennt bestimmte Eiweiße der Katze – allen voran das Protein Fel d 1, das über Speichel, Hautschuppen und Talg abgegeben wird – fälschlicherweise als gefährlich und bekämpft sie wie Krankheitserreger. Dabei werden Botenstoffe wie Histamin ausgeschüttet, die für typische Beschwerden wie Niesen, tränende Augen oder Hautreizungen sorgen. Diese Reaktion kann schon bei sehr geringen Mengen des Allergens auftreten.
Besonders tückisch: Die allergieauslösenden Stoffe sind extrem fein und können sich schnell verbreiten, sei es über die Luft, über die Kleidung oder über Oberflächen.
Entscheidend ist nicht der direkte Kontakt mit der Katze, sondern die individuelle Empfindlichkeit des Betroffenen. Während manche Menschen kaum Symptome zeigen, reagieren andere schon auf kleinste Mengen heftig. Warum das so ist, hängt unter anderem mit der persönlichen Allergieneigung, dem Zustand des Immunsystems und dem Vorliegen einer Sensibilisierung – also der immunologischen Bereitschaft zur allergischen Reaktion – zusammen.
Katze trotz Allergie: Gibt es geeignete Rassen?
Auch wenn es keine Katzenrasse gibt, die garantiert keine allergischen Reaktionen auslöst, gelten einige Rassen als vergleichsweise verträglicher für Allergikerinnen und Allergiker. Sie produzieren in der Regel geringere Mengen des allergieauslösenden Proteins Fel d 1 oder verteilen es weniger stark in ihrer Umgebung. Zu diesen Rassen zählen:
Wie stark auf eine Katze tatsächlich reagiert wird, ist jedoch individuell verschieden und eine gewisse Restunsicherheit bleibt immer.
Nacktkatzen wie die Sphynx-Katze, Devon Rex Katze und Cornish Rex Katze verlieren weniger oder keine Haare, mit denen sie die Allergene eigentlich verteilen würden. Da das Hauptallergen Fel d 1 aber über Speichel und Hauttalg übertragen wird, können auch haarlose Katzen allergische Reaktionen auslösen. Leider geht die Haarlosigkeit mit gesundheitlichen Problemen einher.
Mehr über Katzen für Allergikerinnen und Allergiker
Behandlung der Katzenallergie – ist das möglich?
Eine Katzenallergie kann den Alltag stark beeinträchtigen. Wer sich mit einer plötzlichen Katzenhaarallergie konfrontiert sieht, fragt sich schnell: Was kann man bei einer Katzenallergie tun? Neben vorbeugenden Maßnahmen gibt es auch medizinische Möglichkeiten, die Beschwerden gezielt zu behandeln.
Zu den gängigsten Optionen zählen Antihistaminika, die akute Reaktionen wie Niesen, Augenjucken oder Hautreizungen lindern, sowie kortisonhaltige Nasensprays oder Augentropfen bei entzündlichen Reizungen der Schleimhäute. Bei mittelschweren bis schweren Allergien kommt eine so genannte Hyposensibilisierung - auch spezifische Immuntherapie oder Desensibilisierung genannt - in Frage.
Dabei wird das Immunsystem schrittweise an das Katzenallergen gewöhnt, indem über einen längeren Zeitraum kontrollierte Mengen des Allergens verabreicht werden. Das Ziel dieser Behandlung ist es, die Immunreaktion des Körpers langfristig zu verändern. Die Bildung der allergieauslösenden Antikörper soll so beeinflusst werden, dass das Allergen nicht mehr als Bedrohung erkannt wird. Dadurch können die Beschwerden oft deutlich gelindert werden – ein vollständiges Verschwinden der Symptome ist jedoch selten und hängt stark vom individuellen Fall ab.
Ob eine Hyposensibilisierung im individuellen Fall sinnvoll ist, in jedem Fall ärztlich besprochen werden.
Ist es möglich, die Katze trotz Allergie zu behalten?
Die Diagnose Katzenallergie ist für viele Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer zunächst ein Schock, vor allem wenn das Tier schon lange zur Familie gehört. Der Gedanke, sich von der geliebten Samtpfote trennen zu müssen, ist für viele kaum vorstellbar. Doch es gibt gute Nachrichten: Ein Zusammenleben mit der Katze trotz Allergie ist in vielen Fällen durchaus möglich, auch wenn es Kompromisse und ein Umdenken erfordert.
Entscheidend ist die ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Belastungsgrenze: Wie stark sind die Beschwerden wirklich? Welche Maßnahmen lassen sich dauerhaft im Alltag umsetzen? Nicht jede Lösung passt zum eigenen Lebensstil und ist umsetzbar.
Hilfreich sind vor allem feste Routinen im Umgang mit der Katze. Dazu gehören zum Beispiel klare Rückzugsorte für Mensch und Tier, die regelmäßige Reinigung von Textilien, gezielte Lüftungszeiten oder der Einsatz von Luftreinigern. Schon kleine Veränderungen im Alltag können einen großen Unterschied machen, wenn sie konsequent umgesetzt werden.
Es gibt zudem spezielle allergenreduzierende Katzenfutter, die dazu führen, dass Ihre Katze weniger Allergene verteilt. Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt kann Sie hier beraten, ob ein solches Futter für Ihre Katze in Frage kommt.
Erfahrungsberichte zeigen: Mit Struktur, Rücksicht und ärztlicher Begleitung ist ein Leben mit Katze trotz Allergie möglich.
Wer gut informiert ist und bewusst handelt, muss als Katzenallergikerin oder Katzenallergiker nicht gleich auf das Zusammenleben mit der eigenen Samtpfote verzichten.
Katzenallergie bei Kindern: besondere Herausforderungen
Eine Katzenallergie bei Kindern stellt oft eine besondere Herausforderung dar. Das liegt nicht nur an den gesundheitlichen Folgen, sondern auch an der emotionalen Bindung, die viele Kinder zu ihrem Haustier aufbauen. Umso belastender ist es, wenn allergische Reaktionen das Zusammenleben stören oder gar den Abschied vom Tier notwendig machen.
Besonders wichtig ist es, die Symptome frühzeitig zu erkennen. Typische Symptome sind Schnupfen, verstopfte Nase, juckende oder tränende Augen. Diese Beschwerden werden leicht mit einer Erkältung verwechselt. Auch Hautausschläge, Husten oder Atemnot können auftreten. Gerade bei Kindern ist es wichtig, frühzeitig zu reagieren, da unbehandelte allergische Reaktionen in ein allergisches Asthma übergehen können. Um Gewissheit zu erlangen, empfiehlt sich ein zeitnaher Katzenallergie-Test. Er gibt Ihnen Klarheit darüber, ob Ihr Kind tatsächlich allergisch auf Katzen reagiert. In manchen Fällen könnte eine Allergologin oder ein Allergologe Tests zur Bestimmung der Allergene vorschlagen. Diese Tests sind besonders wichtig, da Katzenallergene äußerst hartnäckig sind und sich schnell im gesamten Wohnraum verteilen können.